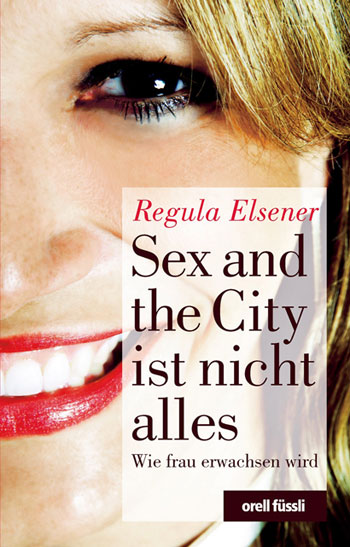
«Sex and the City ist nicht alles»
(Auszüge)
…Hast du gemeinsam Kinder, bist du ein Leben lang aneinander gebunden. Am Besuchstag in der Schule, an der Aufführung im Ballett, am Fussballmatch, beim Schulabschluss - du läufst dir immer wieder über den Weg, ob du das willst oder nicht. Natürlich werden die Kinder irgendwann erwachsen, aber sie bleiben die gemeinsamen Kinder. Es kann aber natürlich durchaus auch sein, dass der Mann ein Leben lang an meiner und ich an seiner Seite bleibe. Dann stellen sich diese Man-sieht-sich-der Kinder-wegen-Situationen ja gar nicht erst ein.
Dieses lebenslange 24-Stunden-Verpflichtungsrisiko gehst du jedes Mal dann ein, wenn du mit einem potenziellen Samenspender mehr als nur Höflichkeiten austauschst - auch die beste Verhütung kann zu einer zwar ungewollten, aber sicher nicht grundlosen Gewichtszunahme führen. Den Satz: «Das könnte mir NIE passieren», nehme ich jedenfalls lieber nicht in den Mund. Denn manchmal hat das Schicksal eigenartige Kurven und Wege für dich ausgesucht.
Entscheidend ist für mich, dass beide dieses Risiko zumindest sehen.
«Mit einem Mann, der dich in diesem Punkt nicht ernst nimmt solltest du dich erst gar nicht einlassen. jawohl!» Diesen Satz hörst du als junges Mädchen schon zig Mal, bevor überhaupt deine erste Menstruation einsetzt und du herausfindest wovon die alle sprechen.
Und doch würde wohl keine Frau den Liebesakt unterbrechen, um noch kurz nachzufragen, ob er sich bewusst sei, dass genau in diesem Moment trotz Pille, Kondom oder was auch immer, eine kleines Restrisiko für ihn besteht, Vater zu werden. Seien wir ehrlich - das «Danach» interessiert dich in jenem Moment reichlich wenig. Auch wenn es sich generell sicherlich lohnen würde, den einen oder anderen Gedanken diesbezüglich aufkommen zu lassen.
Fazit:
Manchmal lohnt es sich nachzudenken, denn setzen erst einmal die Wehen ein, nützt es wenig, sich zu fragen, wie es um Himmels willen eigentlich dazu kommen konnte…
-----------------------------------------------------
Ab und zu brachte eine Zeitschrift einen Artikel über mich, wenn ich zwischendurch einmal eine Abendsendung moderierte. Ich fragte mich dann oft: «Was denkt nun wohl die Person, die das liest, über mich?» Das konnte mir ja eigentlich egal sein. Doch ich neigte schon immer dazu, mich ständig zu fragen, was für ein Bild wohl andere von mir hatten.
«Willst du eine ehrliche Antwort darauf, musst du den Job wechseln.» Das hatte ich schnell begriffen. Denn als Moderatorin wird frau überdurchschnittlich oft angelogen, wenn es darum geht, über die eigene Person zu reflektieren. Ich war immer wieder nahe daran, das Fernsehen zu verlassen und etwas ganz anderes zu machen. Sozialarbeit war ein Thema, eine eigene Eventagentur oder nochmals ins Ausland gehen. Doch ich blieb. Ein Kollege, der über dreissig Jahre beim TV gearbeitet hatte, sagte einmal zu mir: «Ich verstehe dich. Auch ich habe gekämpft. Es gab Zeiten, da hasste ich das Fernsehen. Aber jedes Mal, wenn ich gehen wollte, hat es mich in der letzten Sekunde wieder gepackt.» Es ist nicht einfach, einen so faszinierenden Job loszulassen - obwohl die TV-Welt viel weniger nach Glitzer- und Glamour riecht, als die meisten meinen.
Wie unterscheidet sich aber das Fernsehen von anderen Firmen? Zuerst einmal identifizieren sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unglaublich stark mit ihrem Arbeitgeber. Es gibt Leute, die würden sich wohl «Ich arbeite beim Fernsehen» sogar auf die Stirne tätowieren lassen (damit es auch wirklich jeder sehen kann, der sonst Gefahr läuft, es nicht zu merken).
Und bei Prominenten, seien das nun Moderatoren oder Sonstige, gibt es für mich zwei Sorten: zum einen jene, die mich wirklich ernsthaft nerven mit ihrer Überheblichkeit und ihrer Arroganz. Sie gehen nicht, sie stolzieren, sie sprechen nicht, sie säuseln, und sie haben oftmals keine Ahnung, wie sehr sie belächelt werden. Aber es gibt wirklich auch die anderen, die schlicht und einfach okay sind. Oder sogar nett. Einige sogar sehr nett.
1800 Leute arbeiten in dieser Firma, da sind die üblichen Idioten dabei, aber die grosse Masse ist nicht besser oder schlechter als irgendwo sonst. Nur eben ein bisschen extrovertierter…
-----------------------------------------------------
…Am häufigsten musste ich zu den Terminen, wenn es um Interviews mit «Boygroups» ging. Von «Caught in the Act» über «Take that» bis zu den «Backstreet Boys»! Das waren in den meisten Fällen keine hoch stehenden Gespräche, aber dafür wurde viel gelacht.
Allerdings fragte ich mich danach immer ernsthaft was an denen so furchtbar toll sein sollte. Sie waren nett ja. Aber nett sind der Müller Toni, der Meier Jörg oder der Huber Sepp auch - sprich: Nett sind viele Menschen, ohne dass ich deswegen in Ohnmacht fallen müsste. Und was bedeutete schon das Wort «Star»?
Aber halt! Ich will ehrlich sein: Einmal passierte es auch mir, dass meine Hormone verrückt spielten, als mir ein so genannter Star begegnete.
Er war Gast in «Megaherz», einer Quiz-Show, die damals jeden zweiten Montagabend lief. Ich hatte mit dieser Sendung aber nichts zu tun und wusste nicht einmal, dass er und seine Bandkollegen dort eingeladen waren.
Es war Montagmorgen, ich war übermüdet vom Wochenende und kämpfte gegen den üblichen Frust zu Wochenbeginn. In der Hoffnung, wenigstens ein bisschen wacher zu werden, schlurfte ich zum Kaffeeautomaten, um mir erst einmal einen Espresso rauszulassen. Der Weg führte an den Künstlergarderoben vorbei, die zu den grössten beiden Studios gehörten.
Unerwartet öffnete sich eine der Garderobentüren, und da stand er vor mir: Morten Harket! Ich habe ihn geliebt! Er war der erste Mann, der wohl so etwas wie feuchte Träume bei mir auslöste. Mit 14 war ich ein totaler Fan seiner Popgruppe «Aha» und hätte alles getan, um ihn zu treffen! Nun tat ich es - an einem Montagmorgen, in einem kargen, hässlichen Korridor. Genau so karg und hässlich wie ich mich an jenem Morgen fühlte. Ungeschminkt und im Schlabberlook. Er sah immer noch verdammt gut aus! Natürlich war auch er lo Jahre älter geworden, genau wie ich…
Aber so hatte ich mir ein Treffen mit Morten Harket natürlich nicht vorgestellt - damals mit 14. Nun mussten wenigstens meine Worte diesem aussergewöhnlichen, einzigartigen und schicksalsträchtigen Moment die nötige Würde verleihen.
Ich räusperte mich, um noch eine Sekunde länger überlegen zu können. Dann öffnete sich mein Mund wie von selber, und ich hörte mich sagen: «Ähm, hello».
Wie bitte? Ich treffe mein Jugendidol und alles, was mir einfällt zu sagen, ist: «Ähm, hello»? Was musste er bloss von mir denken! Nilpe, Tröte, langweilige Gasflasche.
Er lächelte, nickte mir zu und verschwand wieder in seiner Garderobe. Kaum war die Tür zu, erwachte ich aus meiner Erstarrung. Hatte ich eben nur geträumt dass Morten Harket mir begegnet war - an diesem Montagmorgen, in diesem kargen, hässlichen Korridor? Vorsichtig schlich ich mich näher zur Tür und las das Garderobenschild: AHA. Aha - es war also doch kein Traum!
Morten Harket und seine beiden Kollegen hatten gerade ein fulminantes Comeback hingelegt und waren deshalb auch in der Schweiz auf Promotionstour. Ich dachte nur: «Scheisse, Scheisse, Scheisse!» So dämlich konnte wirklich nur ich ich sein. Sollte ich an die Tür klopfen und ihm charmant lächelnd erklären, dass ich gerade eben etwas verwirrt gewesen sei und deshalb nichts Gescheiteres gewusst hätte zu sagen? «Sorry, Morten, but I was so surprised and confused. Please give me a second chance to show you how great I am!»
Das fand ich dann aber doch zu peinlich und liess es bleiben. Seufzend und am Schluss gar ohne Kaffee - den hatte ich in der Aufregung vergessen - schlurfte ich zurück in mein Büro. So lebte ich fortan mit der frustrierenden Gewissheit dass Morten Harket niemals erfahren würde, wer ihm da begegnet war - an jenem Montagmorgen…
-----------------------------------------------------
…Zu dritt waren wir nach Tansania gereist. Nebst meinem Bruder, der Mitte dreissig war, begleitete uns ein gut 6o-jähriger Freund von ihm. Dieser hatte alles wunderbar organisiert! Schon Monate vorher hatte er begonnen, Briefe an seine Bekannten in Tansania zu schreiben, in denen er unseren Besuch ankündigte. Wir mussten uns wirklich um nichts kümmern, konnten diese Zeit einfach auf uns zukommen lassen.
Kaum angekommen, wurden wir am Flughafen abgeholt und zu einer Missionsstelle von Dar es Salaam gebracht. Dort gab es Milchkaffee und Brot. Das Geschirrset war fast das gleiche wie es meine Oma früher benutzte. Der Kaffee schmeckte ähnlich wie bei uns, die Butter war weich, aber ebenfalls so, wie ich es gewohnt war. Wir sassen in einem Raum, der sich von einem karg eingerichteten Zimmer in der Schweiz kaum unterschied. Eine Wanduhr tickte.
Ich war ein erstes Mal irritiert, wusste aber eigentlich nicht so richtig, warum. Afrika! Was sollte ich mir darunter vorstellen? Hatte ich erwartet, im Busch zu landen, dann in eine Baumhütte gebracht zu werden, dort aus einer Kokosnussschale einen undefinierbaren Saft zu trinken und von weitem wilde Tiere zu hören? Ich weiss es nicht.
Vielleicht lag es auch an der Hitze und der Müdigkeit, dass ich mich einen Moment lang ziemlich verloren fühlte. Ich war froh, dass mein Bruder dabei war. Er strahlt immerzu eine Art heroische Ruhe aus. Dann zeigten sie uns die Zimmer. Natürlich wurde ich - von den beiden Männern getrennt - im Frauentrakt untergebracht. Das Zimmer war sauber, doch die Hitze fast unerträglich. Ich stellte die Klimaanlage ein. Die ratterte so laut dass man kaum hätte in normaler Lautstärke sprechen können!
«Das wird ja eine unterhaltsame Nacht», dachte ich noch so für mich, als mich plötzlich zwei Augen anschauten. Ich erschrak. Das Wesen mir gegenüber wohl auch, denn schwups! war es weg. Es muss eine Eidechse oder so etwas gewesen sein. Richtig erkennen konnte ich es nicht.
Vielleicht wollte ich es aber auch gar nicht so genau wissen - jedenfalls hatte es in meinem Badezimmer nichts zu suchen. Genauso wenig wie die vier Kakerlaken in der Dusche. Ich schluckte, seufzte und entschloss mich, ab sofort nur noch mit geschlossenen Augen aufs Klo zu gehen, unter kein Bett zu schauen, keinen Schrank zu öffnen und vor allem mein Etepetete-Getue unverzüglich abzulegen. Verdammt ich war in Afrika und nicht in Zürich-Schwamendingen!…
-----------------------------------------------------
Nun sassen mir etwa sieben solcher Männer gegenüber. Eigenartig war, dass sie mich kaum anschauten. Es war ohnehin eine Ehre, dass sie mich in ihrer Mitte duldeten. Normalerweise assen keine Frauen mit ihnen. Für Schwester Katharina und mich machten sie eine Ausnahme. Wobei ich auch nicht wirklich etwas essen konnte. Um genauer zu sehen, was die Massai für uns kochten, zoomte ich mit meiner Kamera so nah als möglich in den Topf hinein, der mitten in der Wildnis über einem Feuer hing.
Es haute mich fast um! Wie um Himmels willen schaffte ich es, dass ich das nicht essen musste? Ich fühlte, wie mir nur schon vom Anblick leicht übel wurde. Ich schlich mich zu meinem Bruder, der mir irgendetwas von «Würg es halt runter, wir können nicht unhöflich sein» zuflüsterte.
Ich nahm also ein Stück Fleisch in die Hand, als mir eine Schale mit dem ominösen Inhalt des Topfes hingehalten wurde und knabberte eine halbe Stunde lang daran herum. Da ich dabei, so gut es ging, immer lächelte, fiel es nicht so auf, dass ich kein zweites oder gar drittes Stück nahm.
«Oh, that's nice, assante sana (vielen Dank), log ich, als sie uns für den nächsten Tag noch einmal zum Essen einluden. Ach du meine Güte, hoffentlich reichte der Alkohol! Mein Bruder hatte nämlich einen Schnaps mitgenommen, um alles abzutöten, was in unserem Verdauungstrakt hätte weiterleben können. Gut getarnt in einer Mineralwasserflasche war der Schnaps überall dort wo wir auch waren.
An diese Flasche hängten wir uns also nach fast jedem Essen und blieben so die ganze Zeit über von Krankheiten und sogar vom obligaten Durchfall verschont. Mit dem nächsten Tag kam auch das nächste Essen bei den Massai. Diesmal gab es etwas Kleines, Dunkles, Getrocknetes, das mit dem Essen vom Vortag einzig gemein hatte, dass es wiederum undefinierbar war.
«Ich glaube, das sind Heuschrecken oder so was», flüsterte mein Bruder mir zu und machte mir damit wenig Hoffnung. Einmal mehr überlegte ich, ob ich nun eine theaterreife Szene hinlegen sollte, damit ich mich vor dem Essen drücken konnte, oder ob das Motto schlicht lautete: Augen zu und durch! Ich entschied mich für das Zweite und nahm artig so ein Ding in die Hand. Komisch! Es schmeckte eigentlich ganz gut und gar nicht so ungewohnt.
Nun getraute ich mich auch zu fragen, was dieses Ding in meiner Hand denn war. Bis zu diesem Zeitpunkt vertrat ich die Ansicht dass es in gewissen Momenten im Leben besser war, nicht alles zu wissen.
Ein Massai klärte mich nun auf, dass es sich um getrocknetes Rindfleisch handelte! Von wegen Heuschrecken! Ich schaute meinen Bruder gespielt böse an. «Hätte ja sein können», meinte er und lächelte mich frech an.
Kurz darauf servierten sie uns dann eine besondere Spezialität: saure Milch. Ich fiel fast vom Holzhocker, den sie mir als Sitzunterlage gegeben hatten. Die schaute aus wie meine Milch zu Hause - wenn ich sie ein halbes Jahr hatte stehen lassen. Nein, bei aller Liebe, das konnte ich nicht! Unmöglich!
Ich wollte flüchten, einfach weg! Bitte, bitte, lasst mich das nicht trinken! Für ein paar Augenblicke fühlte ich mich wie E. T.: «Nach Hause telefonieren! Nach Hause, nach Hause!» Aber ich konnte nicht nach Hause. Ich sass hier im Busch! Um mich herum etwa ein Dutzend Massai-Männer, die mir mit ihrer Milch eine Freude machen wollten. Das Unbehagen schien mir ins Gesicht geschrieben.
Einer der Massai sah mich fast schon mitfühlend an und erlöste mich in zebrochenern Englisch: «You not drink, when you not want.»
Ich liebte sein Englisch in diesem Moment, egal ob es perfekt war oder nicht. Ich hörte die beiden Worte «not drink», das reichte mir vollkommen. Ich spürte, wie sich meine Anspannung langsam löste. Der Massai hatte eigenartigerweise sehr europäische Gesichtszüge und gefiel mir mit Abstand am besten von allen. Den musste ich a) unbedingt noch fotografieren und hätte ihn b) in jenem Moment am liebsten umarmt!…
-----------------------------------------------------
…Der dritte Besuch beim Schamanen brachte mich dann ziemlich aus der Fassung. Er erklärte mir, dass ich nun eine Reise «nach oben» machen würde. Ich wurde nervös, hatte ich doch noch immer das Ziel, meine Schwester zu treffen. Also sah ich mich wenige Augenblicke später durch dickere und dünnere Schichten kämpfen, die nach «oben» führten - wo immer das auch war. Endlich hatte ich es geschafft. Der Weg dahin war anstrengend. Ich fühlte mich müde und abgekämpft. Nach diesen Strapazen hatte ich keine grosse Lust mehr, hier zu bleiben.
Ich sah mich um. Im ersten Moment konnte ich nichts erkennen, ein grelles Licht blendete mich. Langsam wurden die Bilder klarer. Ich befand mich in einer völlig weissen Welt. Alles war weich und in Bewegung, als ob ein permanenter Rauch über dem Boden schwebte. Der Boden gab bei jedem Schritt nach. Ich hatte das Gefühl, über diese gummigen Süssigkeiten zu gehen, die ich so eklig fand - wie hiessen sie nochmals? Marshmallows! Gehen war ohnehin der falsche Ausdruck, es war schon eher ein Schweben. Sah so also der Himmel aus? Ich war etwas enttäuscht, hatte ich doch gehofft, etwas Neues, Überraschendes zu sehen. Doch genau so würde wohl jeder Hollywood-Regisseur den Himmel darstellen. Wahrscheinlich hatte ich das sogar schon in dieser Art gesehen, was mich sicherlich beeinflusste. Immer noch blendete mich dieses grelle Licht. Das war vielleicht langweilig hier! Keine Engel, die vorbeiflogen, kein Himmelsorchester. Es herrschte eine eigenartige Stille. Ich fror.
Nun war sie wieder da, meine Ungeduld. Hallo! Ob hier wohl bitte schön endlich was passieren würde? Ich hatte mich ja nicht durch so viele Schichten gekämpft, um hier nun einfach rumzustehen und zu frieren. Ich konnte mich diesmal, im Gegensatz zu den früheren Reisen durch die Höhle, nicht sehen. Dabei hätte ich gerne gewusst, warum mir so kalt war, ob ich vielleicht keine Schuhe trug und meine Füsse deshalb so kalt waren. Langsam ging ich vorwärts, obwohl ich ja nicht wusste, wo vorne und hinten war. Je länger ich ging, desto wärmer wurde mir. Das hatte weniger mit körperlicher Bewegung als vielmehr dem Ansteigen der Temperatur zu tun. Endlich wurde das Licht angenehmer. Ich hatte keine Angst, fühlte mich aber unbehaglicher als in der schönen Heidi-Landschaft. Ich könne jederzeit nach meinem Kraft-Tier rufen, hatte der Schamane gesagt. Schon tauchte es auf und lief neben mir her. Doch irgendetwas hinderte mich daran, die Löwin mitzunehmen. Sie schien es zu spüren und entfernte sich.
Ich beschloss, mir noch einmal vor Augen zu führen, was ich hier eigentlich wollte: meine Schwester treffen. Sie war im Alter von einem Jahr gestorben. War sie «hier» nun auch noch ein Baby? Oder würde sie sich als Erwachsene zeigen? Oder am Ende gar nicht? Auch der Schamane hatte mir darauf keine Antwort geben können. Leise sagte ich ihren Namen. Nichts geschah, Ich hatte inzwischen kein Zeitgefühl mehr, alles erschien mir langsam und endlos. Das kam meinem Naturell überhaupt nicht entgegen. Ich wurde noch ungeduldiger, fand das alles ziemlich mühsam. Da erblickte ich plötzlich wunderschönes rotes, langes Haar. Es gehörte einer Frau. Meiner Schwester? War sie es? Ich konnte nur die Umrisse ihres Gesichtes erkennen. Sie hatte einen gross gewachsenen, schlanken Körper und trug ein weisses Kleid - Farben schienen die hier nicht zu kennen. Ich sah sie eindringlich an. Doch sie beachtete mich nicht obschon sie mich gewiss gesehen hatte. Kalt und arrogant wirkte sie. Das konnte nicht meine Schwester sein. Aber wer war sie, und weshalb behandelte sie mich so herablassend? Ich fühlte mich unwohl. Eine leichte Panik stieg in mir auf. Auf dem Tonband war später gut zu hören, wie mein Atem immer schneller ging. Dann wurde ich wieder ruhiger und hörte mich sagen: «Opa?»
Meine Stimme erhob sich am Schluss des Wortes. Ich sprach es also mehr als eine Art Frage aus. «Opa?» Weshalb fragte ich nach meinem Opa? Ich hatte ihn noch nicht mal gekannt, er starb vier Jahre vor meiner Geburt. «Opa?» Ich spürte seine Gegenwart. Er war da, ganz bestimmt! Tatsächlich sah ich von weitem leicht verschwommen einen kleinen alten Mann mit schütterem Haar. Ich kannte ihn nur von Bildern, aber er hätte es durchaus sein können. Der alte Mann trug einen blauen Pullover - endlich mal ein Kleidungsstück, das nicht weiss war. «Opa» Mein Herz pochte. Trotz der leichten Trance bekam ich alles, was ich spürte und sagte, vollkommen mit. Krampfhaft versuchte ich, ein Bild vor mir zu haben, wie ich auf diesen Mann zuging. Doch ich schaffte es nicht ich war vom Geschehen ausgeschlossen.
Die rothaarige Frau und der alte Mann hielten sich an beiden Händen fest. Sie liessen sich nach hinten fallen, streckten die Arme durch und drehten sich ganz schnell im Kreis. So, wie Kinder das ab und zu beim Spielen machen. Sie drehten sich immer schneller und schneller. Mir wurde schwindlig. Ich wollte dieses Drehen stoppen und den Mann ansprechen. Ich wollte wissen, ob er wirklich mein Opa war. Doch da änderten die Tommeln ihren Rhythmus. «Nein», sagte ich laut und bestimmt. Ich wollte nicht zurück! Nicht jetzt, wo ich im Begriff war, meinen Opa zu treffen. Doch auch diesmal hatte ich keine Chance. Wie ein Magnet wurde ich weggezogen und erneut durch die engen Schichten gequetscht. Ich atmete unruhig, als ich die Augen aufschlug…
-----------------------------------------------------
Wäre ich dreissig Jahre früher geboren, wären wohl auch meine Kriterien, wie ein Mann sein sollte, anders, als sie es heute sind. Die Ansprüche sind ohne Zweifel gestiegen - wobei ich zugeben muss, dass Geld wohl allen Entwicklungen zum Trotz immer noch eine gewisse Attraktivität mit sich bringt. Allerdings nicht in jedem Fall.
Kaum 20 geworden, interessierte sich ein Typ für mich, dem ich bereits nach dem ersten gemeinsamen Abendessen nicht ausstehen konnte. Er fuhr einen teuren Wagen, trug teure Klamotten, schenkte mir teures Parfum, Blumen und was ihm in seiner beschränkten Fantasie sonst noch einfiel. Auf diese Art uncl Weise überredete er mich also, einmal mit ihm auszugehen. Bis dahin hatte sein Geld noch einen gewissen Reiz. Dabei störte es weder ihn noch mich, dass es nicht sein, sondern das Geld seines Vaters war.
Beim Essen in einem äusserst teuren Restaurant, in welchem mir als damals unsagbar schlecht verdienende Radiojournalistin schon von den Preisen auf der Speisekarte jeglicher Hunger verging, zeigte er dann, wie weit sein Charme reichte. Nach einigen Plattitüden und sonstigem Blabla kamen wir auf das Thema «Männer und Frauen» zu sprechen. Lauthals, damit es auch jeder an den Tischen in unserer Umgebung im Detail hören konnte, erklärte er mir, dass ihn ganz generell füllige Frauen überhaupt nicht interessierten. Ich war etwas irritiert brachte er selber doch locker über loo Kilo auf die Waage, und das unübersehbar nicht an Muskelgewicht. Auf diese Aussage folgten noch zahlreiche weitere Lebensweisheiten, die ich mir lieber erspart hätte, bis ich es einfach nicht mehr aushielt und mich auf Nimmerwiedersehen verabschiedete.
Was mich bis heute schmerzt, ist die Tatsache, dass ich mein Essen gerne selber bezahlt hätte, weil es mir äusserst unangenehm war, mich bei einem solchen Menschen auch noch bedanken zu müssen. Aber leider konnte ich es mir schlicht nicht leisten, meine menschliche Überlegenheit ihm gegenüber auch finanziell auszudrücken.
Ich schlief mit dem wehmütigen Gedanken ein, dass es wohl viel verlangt gewesen wäre, wenn sich dieser reiche Mann noch zugleich als Traumprinz herausgestellt hätte. Ich war mal nicht Julia Roberts in «Pretty Woman», die sich nicht nur einen reichen, sondern dazu gleich noch attraktiven und emotional lernfähigen Richard Gere angeln konnte. Aber dafür musste ich zuvor auch nicht auf den Strich gehen.
Mir fiel ein Spruch des Ölmagnaten Jean Paul Getty ein: «Um es im Leben zu etwas zu bringen, muss man früh aufstehen, bis in die Nacht arbeiten - und Öl finden.»
Wobei Letzteres in der Umgebung von Frauenfeld recht unwahrscheinlich ist. Und die Erfahrung mit dem reichen Schnösel hatte mir gezeigt, dass es nicht das Geld allein sein konnte, das es anzustreben galt. Aber was war es denn? Was sollte ich denn anstreben und wie sollte ich das anstellen? Mit genau solchen Fragen habe ich mich schon seit jeher überfordert…
-----------------------------------------------------
Allerdings gehöre ich zu jenen Talenten, die sich das Leben oftmals unnötig schwer machen. Manchmal wünsche ich mir, einfach blöd und oberflächlich zu sein. Aus diesem Satz lässt sich nun schliessen, dass ich mich nicht dafür halte. Sollte jemand da anderer Meinung sein, darf er oder sie das gerne mit mir ausdiskutieren. (Randbemerkung: Ich besuchte einmal sieben Lektionen Karate. Oder war es Judo? Jedenfalls etwas in der Art.)
Da haben wir es! Ich bin schon wieder am Überlegen, was es denn nun war. Welches die korrekte Angabe wäre. Ich könnte aber auch einfach sagen: Ich polier dir die ... ! Aber so etwas sage ich eben nicht. Das würde nicht zu mir passen! Genauso wenig wie dumpfe Oberflächlichkeit. Davon gibt es ja überall genug, gerade auch im Medienbusiness! Einigen würde ich jeweils am liebsten eine klatschen, wenn sie mir mit ihrem süffisanten Lächeln gegenüberstehen und etwas von «Du siehst heute sehr gut aus» säuseln.
Methode eins wäre, solchen Leuten direkt zu sagen, dass ihre Schleimspur von Zürich bis nach Bangkok reicht. Damit schaffst du die sicher keine Freunde. Das ginge ja noch! Im Medienbusiness keine Freunde zu haben ist normal und nicht schlimm, dir Feinde zuzulegen kann hingegen ziemlich ungesund sein! Ich wähle hier also zugegebenermassen den Weg des geringsten Widerstandes, nämlich Methode zwei: den Kontakt meiden!
Na gut auch ich kann manchmal richtig oberflächlich sein! Einmal traf ich in einem Einkaufscenter eine Bekannte und fragte sie - so wie das eben höflichkeitshalber gemacht wird -, wie es ihr denn gehe. Ein schwerer Fehler: ein Schwall von «Mann hat-Freundin-wurde-Verlassen-jetzt-Scheidung-auch-noch Hausverkauf-zudem-Streit-um-Alimente-und-Sorgerecht» überschwemmte mich.
Aber ich musste mir eingestehen: Sie hatte alles Recht dieser Welt, mir das nun zwischen Unterwäsche und Badzusätzen um die Ohren zu knallen. Ich hatte sie ja schliesslich gefragt, wie es ihr geht! Also stand ich dann eine geschlagene halbe Stunde da und hörte mir an, was für ein Versager ihr Mann und was für eine Schlampe seine Freundin sei. Und dass sie vor drei Wochen beim Chatten im Internet einen Mann kennen gelernt habe, der ihr in dieser kurzen Zeit und alleine mit dem geschriebenen Wort mehr gegeben habe, als ihr Mann in den ganzen zwölf Jahren Ehe. Als ich mich dabei ertappte, mich zu fragen, wie er es wohl mit ihr zwölf Jahre ausgehalten hatte, fand ich es dann doch mich zu verabschieden.
So. Jetzt kam ich natürlich zu spät in eine Sitzung. Ich erklärte meinen Kollegen, dass ich einer guten Kollegin (das klang glaubwürdiger als flüchtige Bekannte) hatte beistehen müssen. Diese sei von ihrem Mann (diesem Versager) wegen einer anderen Frau (dieser Schlampe) verlassen worden, und die Freundin (die Ärmste) stecke nun mitten in der Scheidung (einer schmutzigen natürlich). Nun müsse sie auch noch das Haus (ihr Ein und Alles) verkaufen, und für die Kinder (die Leidtragenden) wolle er (dieser Unmensch) auch nicht zahlen.
Die Zwischenfrage, wie viele Kinder die beiden denn hätten, brachte mich für einen kurzen Moment in Bedrängnis - keine Ahnung, aber sie sah recht gebärfreudig aus, also sagte ich spontan vier. Nun hatte ich nicht nur einen verständlichen Grund für mein Zuspätkommen angegeben, sondern bekam für den Rest des Tages auch noch den Mutter-Theresa-Stempel aufgedrückt. Das fand ich insofern ganz okay, weil dadurch nicht so stark auffiel, wie schlecht vorbereitet ich überhaupt in diese Sitzung gekommen war…
-----------------------------------------------------
…Wieso aber um alles in der Welt erzählen alle immer, es sei so einfach, Sex zu bekommen? War es bei meinem Coiffeur vielleicht anders, weil er homosexuell war? Nein, auf dieses blöde Klischee wollte ich nun wirklich nichts geben. Du findest wohl ebenso viele «Sexmaschinen» unter den Heteros wie unter den Schwulen.
Nochmals die Frage: Wieso hält sich das Gerücht so hartnäckig, dass man/frau ganz locker immer und überall Gelegenheit dazu hätte? Ich möchte mal wissen, bei wie vielen das tatsächlich zutrifft.
Vielleicht liegt es an meinem Ruf, meiner Art oder meinem Umfeld. Vielleicht gehe ich an die falschen Orte, kenne die falschen Leute, oder ziehe mich falsch an. Ich gebe jedenfalls laut und offen zu: Bei mir funktioniert das nicht so ruckzuck, auch wenn ich es wollte.
Ich kann nicht einfach in eine Bar gehen, zweimal die Augen aufschlagen und lande dann gleich mit irgendeinem Mann in irgendeinem Bett. Ich sage ja nicht, dass ich das unbedingt will. Es erstaunt mich bloss, wie viele noch immer das Märchen vom schnellen Aufriss glauben. Das Ganze ist doch viel komplizierter - zumindest östlich von Zürich.
Natürlich hängt das stark mit der eigenen Persönlichkeit zusammen. Ich war nie die Frau, die offensichtliche Signale aussendet wie: «Ich will dich! Jetzt auf der Stelle! Nur für diese Nacht!», so wie die leicht bis gar nicht bekleideten Damen in den 0190 Werbespots der deutschen Privatsender.
Schaut mir ein Fremder tiefer in die Augen, lautet mein Signal eher: «Pass bloss auf! Meine Faust findet den Weg in dein Gesicht schneller als du denkst».
Manchmal denke ich, wie schön es doch wäre, in einer knisternden Situation einfach die Zeit anzuhalten, um genau überlegen zu können, wie es jetzt weitergehen soll. Das wäre praktisch. Du hättest dann alle Zeit der Welt, um deinem Traummann beizubringen, dass du, genau du, so unheimlich speziell bist. Er würde es gar nicht merken, alles würde im Unterbewusstsein ablaufen. Eine Art Füttern mit den ultimativen «Vor-dir-steht-die-tollste-Frau-der-Welt»-Infos, während alles in Zeitlupe abläuft.
Wie in der Diebels-Werbung. Da kommt einer in eine Bar, es ist laut, stickig und eng. Doch kaum setzt er sein Glas an, um ein Diebels zu trinken, wird die Musik ruhig und harmonisch, und er vergisst alles um sich herum. Nur dass der Typ während der weiblichen Eroberungsaktion natürlich nicht Bier trinkt, sondern dir in die Augen schaut und erfährt, wie toll du bist.
Dass man mit dir Pferde stehlen kann zum Beispiel. Dass du jederzeit für lange tiefgründige Gespräche zu haben bist. Dass man sich mit dir aber genauso gut über die kleinsten Dinge halb totlachen kann. Dass du da bist, wenn er dich braucht, und weg, wenn er Freiraum nötig hat. Dass es dich nicht stört, wenn er stundenlang Fussball ansieht, und du ihn nicht zwingst mir dir shoppen zu gehen. Dass du nämlich ein ganz selbstständiger Mensch bist, der eine Beziehung als Teamwork und nicht als Abhängigkeitsmuster sieht.
Dass Sex für dich entscheidend ist und nicht einfach noch dazugehört. Dass du ihn hingegen nicht für jede Lampe brauchst, die aufgehängt werden soll, und selber weisst wie man einen Akkubohrer bedient.
Dass du deine Pflanzen genauso vertrocknen lässt oder ersäufst wie er, obschon eine Frau ja angeblich mit grünem Daumen geboren wird. Dass du «Vom Winde verweht» todlangweilig findest und auch nicht heulen musst wenn Leonardo di Caprio mit der Titanic untergeht. Dass du ohnehin zu den weltweit wenigen Frauen gehörst, die weder auf Brad Pitt, Keanu Reeves noch Johnny Depp stehen. Dass du nirgends ein Tattoo hast und schon gar kein Piercing. Dass du eh meist nicht mitmachst, was in Mode ist.
Dass du nur Tee trinken kannst wenn du krank bist. Dass du daür am Morgen erst nach vier Kaffees aus dem Koma erwachst. Dass du Menschen hasst, die sich furchtbar elitär geben. Dass es dich ärgert, nicht wie dein Grossvater als Musikgenie geboren worden zu sein.
Dass du es dein Leben lang bereuen wirst, nicht mehr aus deinem angeborenen Sprachtalent gemacht zu haben. Dass deine Seafood Chowder zum Schreien gut schmeckt. Dass Staub und Spinnennetze treue Freunde von dir sind. Dass an dir ohnehin keine tolle Hausfrau verloren gegangen ist. Dass du nur wenige wirklich gute Freunde hast, aber die dir alles bedeuten. Dass es für dich nichts Schöneres gibt, als in den Arm genommen zu werden und selber in den Arm zu nehmen. Dass du einfach lebst, so wie du es für richtig hältst. Dass du verdammt viel falsch und verdammt viel richtig machst. Dass du einfach ein Mensch bist. Du selber eben…
-----------------------------------------------------
…Warum nur tun Männer gewisse Dinge, die eine Frau niemals tun würde? Sie käme nicht auf die Idee, hätte nicht mal den Hauch eines Gedankens daran, sich so daneben zu benehmen.
Die ganze SMS-Geschichte zum Beispiel: Wenn ich eine SMS kriege im Sinne von «Hallo. Hoffe, dir geht's gut. Ich selbst kann nicht klagen, mache gerade das und das. Gruss xy ... », dann steht für mich fest, dass ich zurückschreibe. Für meine Kolleginnen ist das ebenso klar, nicht aber für die Kollegen.
Als ich einen sehr guten Freund kürzlich fragte, warum er auf zwei SMS von mir nicht reagiert habe, sagte er ganz erstaunt: «Aber du hast mir doch keine konkrete Frage gestellt».
Das war es also! Ein Mann schafft es nicht, einfach spontan einen Gruss zu erwidern oder sich für eine Nachricht zu bedanken. Er braucht immer gleich eine konkrete Aufgabe.
Selbstverständlich passiert das Ganze auch nicht in einer nützlichen Frist. Bei einer Frau kann ich mich darauf verlassen, dass sie auf eine SMS von mir innerhalb von höchstens zwei Stunden reagiert. Wenn nicht dann hat sie einen verständlichen Grund wie Akku leer, mitten im Liebesakt Handy verloren, gerade im Kino, oder aber sie ist sauer auf mich. Einen Grund jedenfalls, den ich nachvollziehen kann.
Allerspätestens nach vier Stunden oder im absoluten Extremfall am nächsten Tag meldet sie sich aber gewiss. Bei einem Mann hingegen kann es locker bis zu einer Woche oder länger dauern, bis eine Reaktion eintrifft. Und dabei hat er noch nicht mal das Gefühl, nun etwas lange gewartet zu haben. Wie viele Frauen schauen wohl bis zu 7oo Mal täglich auf ihr Handy und warten auf eine SMS - und wie viele Männer sind sich dessen überhaupt nicht bewusst…
Wenn man dazu noch so gestraft war wie ich und zwei Jahre In einer Wohnung lebte, in der es nur an genau zwei Orten überhaupt Empfang gab, war es besonders bitter. Machte es endlich Mal «piep», rannte ich wie Carl Lewis in seinen besten Zeiten aus der Küche, quer durch das Wohnzimmer, warf dabei mindestens eine Lampe und zwei Stühle um, zertrampelte fast die Katze, fiel über den Staubsauger und erreichte dann mit einem Hechtsprung das Bett auf dem das Handy lag. Die Belohnung war dann meist ein Gruss der Mutter oder eine dieser bescheuerten Witze- oder Bildchen-SMS. Wie viel einfacher war doch das Leben, als es noch keine mobilen Telefone gab…